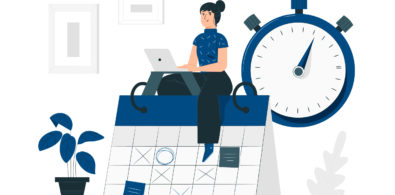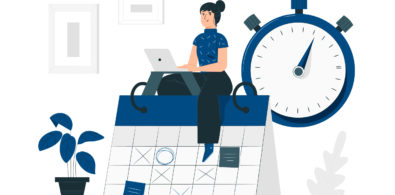Konzerne geben Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus und beschäftigen tausende von Ingenieuren. Wozu benötigt da ein Konzern wie BMW noch Start-ups?
Gregor Gimmy: Es gibt zwei wesentliche Gründe dafür. Erstens besitzen viele Start-ups geschütztes Wissen, an das kein Konzern herankommt. Und zweitens reicht selbst das Entwicklungsbudget eines Großunternehmens nicht aus, um die Vielzahl aller strategischen Herausforderungen selbst zu entwickeln. Für neue, bahnbrechende Technologien wie zum Beispiel die Lasersysteme für autonomes Fahren gibt es dutzende von technologischen Ansätzen. Jeder benötigt über 50 Millionen an Entwicklungskapital. Aber nur wenige Ansätze werden funktionieren. In jedes der unzähligen Entwicklungsprobleme müsste man also hunderte von Millionen investieren. Nur Start-ups können das. Denn die bekommen jährlich über 200 Milliarden an Innovationskapital von den Venture Capitalists.
Hightech kostet so viel Geld, dass noch nicht einmal Google oder Apple das alleine bewältigen können. Auch sie kooperieren daher mit Start-ups. Die technische Grundlage für die Face ID im iPhone stammt von einem israelischen Start-up. Ebenfalls die Grundlage von Google Maps. Wenn ich die beste Technologie haben will – dann kontaktiere ich innovative Gründer, mit einzigartiger Intellectual Property und substantiellen Mengen an Venture Capital.
Was haben die Gründer neben Geld, was die Konzerne nicht haben?

Gimmy: Das sind extrem erfahrene Spezialisten, die oft bereits Jahrzehnte an Top-Institutionen geforscht haben, und sich dann entschließen, mit ihren Erkenntnissen eine Firma zu gründen. In den USA werden Gründerteams sogar von etablierten Professoren aus Elite-Unis wie MIT, Stanford und Harvard gegründet. Für ihre Idee und ihre Patente bekommen manche von ihnen mehrere Millionen Dollar Finanzierung in der Seed-Runde. Damit werden Patente zunächst in frühe Prototypen umgewandelt. Falls diese die Erwartungen erfüllen, werden in der sogenannten A-Runde bereits zweistellige Millionen-Beträge für die weitere Entwicklung bereitgestellt.
Dennoch könnte ein Konzern doch ebenfalls auf diese Weise forschen?
Gimmy: Man darf nicht vergessen, dass auch das bestunterstützte Start-up pleite gehen kann. Das trifft jedes zweite VC-finanzierte Unternehmen. (Weniger als 5 Prozent der Start-ups bekommt überhaupt Venture Capital.) Auf der anderen Seite ist der Aufwand strategische Innovationen umzusetzen, enorm hoch. Allein für die Innovation Autos autonom fahren zu lassen benötigt die Automobilindustrie Forschungs- und Entwicklungsbudget von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr. Wir haben ausgerechnet, dass es 24.000 Start-ups für Autotechnologie gibt – mit einer Investmentsumme von 50 Milliarden Dollar. Das Risiko, davon die Hälfte aufgrund von Insolvenz zu verlieren, kann sich keiner leisten.
Die Antwort lautet also, in die guten Start-ups zu investieren?
Gimmy: Nein, die guten Start-ups benötigen keine Finanzierung von Unternehmen. Für diese gibt es genug unabhängiges Venture Capital. Sicher macht ein Investment von Corporates in Startups hier und da Sinn, vor allem, um die Skalierung einer erprobten Technologie zu ermöglichen oder um das Startup zu akquirieren. Doch das Corporate Venture Capital kann nicht alleine das Innovationspotential aus dem Startup Ecosystem ausschöpfen. Ein Corporate Venture Capitalist beteiligt sich sich nur bei fünf bis zehn Start-ups pro Jahr. . Die Unternehmen benötigen aber hunderte an Technologien pro Jahr. Es macht aber überhaupt keinen Sinn, Anteilseigner von hunderten von Startups pro Jahr zu werden.
Mit welcher Währung lockt Ihr dann die Gründer?
Gimmy: Erstens: Wir kaufen ihr Produkt, statt ihrer Aktien. Wir haben ein Modell entwickelt, wir nennen das das Venture Client Model, bei dem wir konkrete Technologieprobleme mit konkreten Lösungen in der Start-up-Welt zusammenbringen. Statt in diese Unternehmen zu investieren, initiieren wir Gespräche zwischen Gründer und den Kunden bzw. Nutzer einer Technologie, z.B. der BMW-Entwickler von Autonomen Fahren. Verläuft das vielversprechend, identifizieren wir ein Pilotprojekt, um die Technologie zu testen. Und wenn das gut läuft, dann wird die Geschäftsbeziehung fortgeführt. Zum Beispiel indem man eine Technologie lizensiert oder zusammen mit dem Start-up, auf die Serienfertigung vorbereitet. Nach einem ersten Piloten könnte man auch in das Start-up investieren oder es sogar kaufen – aber halt mit signifikant weniger Risiko.
Zweitens: Kurzer Funnel. Als Start-up möchte ich nicht 40mal zum Kunden laufen bis irgendwann einer das Produkt kauft. Wir geben schnellen Zugang zum Kunden, ohne die Bedingungen eines Investments oder einer Exklusivität. Mit unserem Modell verkürzt man die Zeit vom ersten Kontakt mit einem Gründer bis zum ersten Einkauf von Technologie von rund zwei Jahren auf wenige Monate.
Woher nehmt Ihr das Wissen, welche Start-ups etwas taugen?
Gimmy: Nach unserer Definition ist ein Start-up ein Unternehmen, das mit Hilfe von Venture Capital finanziert wird. Damit haben wir einen Mittelsmann, der einen wesentlichen Anteil der Selektionsarbeit leistet. Die guten Investoren sehen sich jedes Jahr zehntausend Businesspläne an und investieren in zehn. Wir profitieren von deren intensiver Due Diligence, indem wir uns an deren Investments orientieren. Hierzu führen wir natürlich weitere Analysen durch. Dabei konzentrieren wir uns darauf, ob die Technologie passat,, denn das ist etwas, das wir am besten beurteilen können.
Welche Venture Capitalists beobachtet Ihr?
Gimmy: Wir konzentrieren uns auf die Early Stage Investoren, als “F&E” Investoren, damit wir von den Technologien zu einem sehr frühen Zeitpunkt erfahren. Das sind zum Beispiel die üblichen Verdächtigen aus dem Silicon Valley wie Sequoia, Andreessen Horowitz und so weiter. Interessant sind aber auch Upside Ventures und First Round Capital oder der Founders Fund. Vermehrt finden wir auch gute Investoren in Israel.
Gibt es auch in Deutschland interessante Investoren?
Gimmy. Für B2B-Konzepte gibt es in Europa leider sehr wenig wie z.B. Atomico (Luxemburg) und Index Ventures (London). Nur in Deutschland gibt es das noch zu wenig. Pfiffige Leute vom Max-Planck-Institut, die einen guten Algorithmus entwickelt haben, müssen heute ins Silicon Valley oder nach Israel gehen, um ordentliche Funding-Summen zu bekommen.
Wie hat sich das Venture Client Modell für BMW gelohnt?
Gimmy. Die Ingenieure haben sehr schnell gemerkt, dass die Start-ups eine gute Quelle für interessante Lösungen sind. Wir konnten seit 2015 jedes Jahr die Zahl der Kooperationen verdreifachen, weil sich das im Unternehmen herumgesprochen hat. Das Risiko, einen Fehler zu machen, ist dabei aber enorm klein. So ein Pilotprojekt kostet zwischen 5000 und 50000 Dollar – und BMW kann dabei die modernsten Technologien testen. Auf diese Weise stellt BMW sicher, keine gute Technik zu verpassen – das wäre unter dem Strich viel teurer. Denn wenn eine Technik wie zum Beispiel die Erkennung von Objekten mit Hilfe von Kameras früher bei einem Konkurrenten statt bei BMW eingesetzt wird, wirkt sich im Bereich mehrerer Hundert Millionen Dollar Umsatz aus.

Wir diskutieren hier über Superlative. Zehntausende von Elite-Start-ups auf der einen Seite, die Konzerne mit ihren riesigen Budgets auf der anderen. Was macht ein typischer Mittelständler, mit seinen 100 Mitarbeitern? Kann der genauso effizient mit Start-ups kooperieren?
Gimmy. Weil das Venture Client Modell sehr einfach ist und keine großen Kapitalkosten braucht, kann es im Prinzip jeder adaptieren. Nicht jede Firma braucht dafür gleich eine ganze Abteilung oder einen externen Dienstleister. Die wichtigste Frage, die sich ein Geschäftsführer stellen muss, lautet: Gibt es ein Angebot an Start-ups in meinem Problemfeldern? Und Tatsache ist: Jedes Unternehmen nutzt ja längst Start-up-Technologie. Wir bei 27pilots zum Beispiel sind 14 Mitarbeiter und nutzen für das Projektmanagement Asana und für Konferenz-Calls Appear.in. Das ist alles Start-up-Technologie und bedeutet sehr geringes Investment. Gleiches gilt auch für Hochtechnologie.
Wann erntet Ihr die ersten Früchte?
Gimmy. Erste Ergebnisse gibt es sofort, nach zwei Jahren erfolgen in der Regel die ersten Kosteneinsparungen. Nach fünf und mehr Jahren spürt man die ersten Auswirkungen auf den Umsatz.
Wer mit Start-ups kooperiert, kann generell folgende Kalkulation machen: Entweder ich beauftrage einen Lieferanten oder Dienstleister, eine Lösung für ein Problem zu entwickeln. Dann wird es ein Angebot geben und sehr schnell die erste Rechnung. So ein Angebot auszuschreiben und zu verhandeln dauert auch gerne über 6 Monate. Wenn man jedoch ein Start-up findet, dass bereits eine Lösung entwickelt hat, spart man sich den ganzen Entwicklungsaufwand, man bekommt eine bessere Technologie und ist auch noch erheblich schneller.
Als Unternehmen muss man bei dieser Art von Kooperation eigentlich nur auf eines aufpassen: Dass man nicht arrogant bzw. paternalistisch auftritt und sich so darstellt, wie es manchmal bei Acceleratoren oder Inkubatoren passiert. Wer 20 Millionen Dollar von einem VC für seine Idee bekommt, bewirbt sich nicht mehr. Die Zusammenarbeit funktioniert nur mit gegenseitigem Respekt und auf gleicher Ebene. Das Wort Bewerbung hat daher bei dieser Zusammenarbeit nichts zu suchen.
Mehr Lektüre
Unsere Kollegen von Indeed Innovation beschreiben in ihrem Beitrag „Makler zwischen zwei Welten“ sechs Hürden des Technologietransfers, die bei der effizienten Kooperation mit Start-ups ausgeschaltet werden können.
Nicht verpassen. Unser Innovation Briefing bietet Ihnen jeden Monat aktuelle Trends, Tools und Beispiele für Ihre Innovation Journey.

Michael Leitl
Director Strategy bei TOI. 15 Jahre betreute er Wissenschaftler und Berater bei der Veröffentlichung von neuen Innovations-, HR- und Marketing-Beiträgen bei der deutschen Ausgabe der Harvard Business Review. Er unterstützte das Innovationsteam des SPIEGEL-Verlags beim Aufbau des Innovationsmanagements und ist Mitgründer der Startups Pocketstory und Styled.by.
Weitere Beiträge